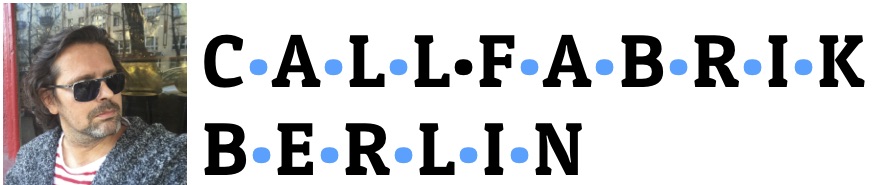Es gibt Tage, da fühlt man sich wie die SPD unter Nahles. Orientierungslos, voll der Fragen, leicht verärgert. Bei mir ist das immer wieder so, wenn ich mich mit den Themen queere Emanzipation und Diskriminierung herumschlage. Und wenn ich, nach dreißig Jahren bewusster Arbeit an dieser Baustelle, stets an Grenzen angelange, wo Herzrasen und Schnappatmung einsetzen, und ich nur brüllen möchte: „Gottverflucht, Ihr blöden Tunten, habt Ihr denn gar nichts kapiert?“.
SPD unter Nahles eben.
Derzeit schaue ich „Pose“ auf Netflix – eine Serie, die in der Drag-Szene der 1980’er in NYC angesiedelt ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf der Doku „Paris is burning“ fußt, die 1990 in die Kinos kam und Glanz und Elend der Transen und Tunten beschrieb, die sich jeden noch so dürftigen Schritt vorwärts in ihrem Elendsdasein erkämpfen mussten, sich prostituieren, in einen Strudel aus Drogen, Gewalt und AIDS verstrickt eigentlich zum Scheitern verurteilt waren, trotzdem nicht aufgaben und jenes Sandkorn Würde in sich zerrieben, bis es, und sei es für Momente bloß, als Perle erstrahlte. Lose flackernde Kerzen in dunkelster Zeit.
„Pose“, geschöpft von Serienerfinder Ryan Murphy, nimmt sich dieser Menschen an, setzt sie in den Mittelpunkt. Aussätzige, selbst von Randgruppen ausgegrenzt. Nicht einmal für die Schwulen gut genug, und für die reichen weißen Männer im Trump-Tower exotische Gespielinnen. Alleine schon, diesen Charakteren eine Plattform jenseits der Schatten, in die sie bis heute von der Gesellschaft wohlfeil gedrängt werden, zu geben, ist von tadelloser Gesinnung. Und dass ein Streamingdienst wie Netflix offensichtlich sehr gutes Geld ausgibt, um ein hochwertiges Produkt abzuliefern, stimmt optimistisch.
Tatsächlich wird in „Pose“ an nichts gespart – die Ausstattung schwelgt, die Besetzung der Nebenrollen ist auserlesen, die Dialoge sind geschliffen. Da kann man auch gerne darüber hinwegsehen, dass bei der Schilderung von „Glanz und Elend“ das Elend weitgehend ausgelassen wird, was der Tiefe einiges an Spitzen nimmt. Schrill geht es zu, laut und bunt und real queer. Die Show ist auf ein Mainstreampublikum angelegt, sie soll auch und vor allem Menschen ansprechen, die mit der Szene nicht vertraut sind, sie soll Türen öffnen, und das ist gut so.
Umso befremdlicher erscheint mir, dass die Hauptrollen mit queeren Menschen, mit Transen und Tunten, besetzt wurden. Denn diese politisch korrekte Entscheidung erweist sich in vielen, leider auffallend vielen Momenten als Bärendienst.
Für den am kommenden Sonntag ausgestrahlten Polizeiruf 110, „Zehn Rosen“, der ebenfalls im Transgendermilieu spielt, suchte die ARD vergebens nach einer transsexuellen Hauptdarstellerin, weshalb man, hüstelnd sich entschuldigend, auf eine Schauspielerin zurückgriff – also eine Urfrau oder Echtfrau oder einfach-nur-Frau. Das ist nun auch nicht weiter verwunderlich. Denn die Darstellungskunst ist ein zu erlernendes Handwerk. Und da es nicht gnadenlos hochbegabte Heerscharen Transsexueller gibt, die diese Kunst beherrschen, musste man eben auf das altmodisch traditionelle Mittel zurückgreifen, eine Schauspielerin zu besetzen, die die Rolle ausfüllen kann, egal was sie ihr abverlangt.
Denn etwas zu „spielen“ heißt nicht, es extrovertiert auszuwalzen. Der Darsteller des Hamlet kann schwarz oder weiß sein, Asiate oder Eskimo, Männlein oder Weiblein, alt oder jung, Riese oder Pygmäe, und, ja!, auch eine Transe. Hauptsache, er/sie/es kann die Figur gestalten, sie zum Leben erwecken, ihr Empathie verleihen. Da ist es wirklich scheißegal, ob er nun Däne ist oder je den Zeh in skandinavische Gestade dippte.
Das ist das große Missverständnis, dem entfesselte Aktivisten und wohlwollende Produzenten im Umgang mit Kunst und Literatur, und von da aus mit vielen weiteren Lebensbereichen, auf den Leim gehe: Man muss etwas nicht sein, um es anzuempfinden. Gerade Abstand fordert die Sehkraft heraus.
In Bezug auf „Pose“ sind die Folgen leider für Sequenzen verheerend. Im Mittelpunkt steht da beispielsweise der 17jährige Damon, der aus der Provinz kommt, von den Eltern vor die Türe gesetzt wurde, und nun im Haus der Transe Blanca Evangelista Unterschlupf findet, von ihr auf die Tanzschule geschickt (Billie Eliott lässt grüßen), bemuttert und diszipliniert wird. Darsteller Ryan Jamaal Swain wirft sich mit Herzblut in die Rolle, zappelt und flennt und gibt sein Bestes – allein, es ist in keiner Sekunde gut genug. Er ist, das kann und will er gar nicht verleugnen, eine Tunte des Gründungskomitees. So zahnfleischzersetzend schwul, dass es wehtut. Und so gnadenlos untalentiert, dass man ihm das blöde Kuhgrinsen ein ums andere Mal aus der Visage polieren möchte – es genügt nicht, zu sein, remember? Damit verliert die Show eines ihrer größten Potentiale – die Identifikationsfigur, mit der man als Zuschauer in diese fremde Halbwelt taucht, mit der man gemeinsam durch diesen Irrgarten wandelt.
Bei anderen Figuren funktioniert der Kunstgriff bisweilen – bei den Dragqueens. Aber er stößt stets an seine Grenzen, sobald „Spiel“ gefragt ist. Wenn es leise wird, wenn der Charakter sich von der privaten Persönlichkeit seines Erfüllgehilfen verabschiedet; eben immer dann, wenn beim Kunstgriff die Kunst gefragt ist. Da werden vorgeblich hintergründige Dialoge unfreiwillig komisch, emotionale Zustände verwandeln sich in grimassierende Possen, und das Drama will bei allem Pathos einfach nicht zur Tragödie gerieren. Das Konzept mag ehrenhaft sein, die Verwirklichung scheitert an ebendieser Ehrenhaftigkeit. Da bleibt dann das Wort Papier, das Gefühl kommuniziert, aber nicht ausgelebt.
So ist das nun einmal mit Konzepten: Sie entstehen am Reißbrett. Ihre Umsetzung ist ein anderes Ding. Und deshalb klafft zwischen „Paris is burning“ und „Pose“ ebendiese gewaltige Schlucht, wie derzeit in der Debatte um Diversity und Gendergerechtigkeit im Gegensatz zum realen Leben.
In einer Szene von „Pose“ geht Transe Blanca in eine Schwulenbar. Sie wird nicht bedient, denn es sei keine Dragnight. Daraufhin empört sie sich, sie sei keine Dragqueen, sondern eine Frau, woraufhin der Bartender sie erst recht rausschmeißt, weil Frauen in einer Schwulenkneipe nichts zu suchen haben. Eigentlich, möchte man meinen, hat sie das Maximalziel erreicht – als Frau akzeptiert und entsprechend ausgegrenzt zu werden. Doch das weckt den Kampfgeist in ihr – solange will sie den Schuppen heimsuchen, bis sie darin bedient wird.
Die Haltung der Macher zu diesem Vorgang scheint mir nebulös – ich hab die Staffel noch nicht bis zum Ende eingeworfen. Aber er ist für mich auf seltsam aktuelle Weise treffend: Wenn ich gerade mal nicht diskriminiert werde, dann finde ich ganz sicher einen Ort, wo es geschieht.
Mir scheinen gewisse Grupperungen der Szene unterdes so Krawall-gebürstet, dass sie wie die Trüffelschweine auf Konfrontationskurs gehen, um ja im überschaubaren Dornennest der Unterdrückung ihren Platz zu behaupten. Letzthin las ich einen verwirrenden Artikel, in dem sich Moppel darüber beschwerten, in der Community keine Lobby zu haben. WIE BITTE? Ich gehöre unterdes selbst zur Übergewichtsfront. Das nimmt mich von der Teilhabe gewisser Events aus. Und es werden sich auch nicht 19jährige verstohlen nach mir umdrehen, weil sie meinen fetten Arsch ganz unbedingt für sich beanspruchen wollen. Woran liegt das wohl? Weil ich ohne Lobby diskriminiert werde? Oder, andersherum: Könnte es mit MIR zu tun haben?
Feministinnen beklagen, „Frauenkunst“ würde nicht genug gewürdigt, ungeachtet der Tatsache, dass es so was wie „Frauenkunst“ nicht gibt, und dass sie, wenn es sie gäbe, kein bisschen besser wäre als „Nazikunst“ oder „Sozialismuskunst“ – aufoktroyierter Etikettenschwindel eben, wie dieser ganze Konzepttrash.
Oder Homo-Darstellertruppen, die bejammern, ihre aktuelle Produktion würde nicht genommen, weil sie thematisch „zu schwul“ sei, und nicht eine Sekunde den Hauch des Gedankens daran verschwenden, dass sie vielleicht einfach nur schlecht ist. Dass sie wieder mal, wie Derek Jarman einst, den ausgelatschten Edward II. bemühen, um das Thema Homosexualität auf die Bretter zu hieven. Dass es einfach nicht reicht, das Wort „schwul“ in die unschuldige Umwelt zu rülpsen, um relevant zu sein. Dass die publizierende, die darstellerische Kunst kein Selbsterfahrungskurs ist.
Ja, das macht mich ärgerlich, das macht mich zur SPD unter Nahles, nur nicht eben so dauerhaft paralysiert. Dass Begriffe wie Diskriminierung und Ausgrenzung durch solcherlei Nießnutzung bis zur Unkenntlichkeit relativiert werden und dem neokonservativen Gegner, dem Populisten, dem Fascho in die glitschigen Hände spielen. Denn dafür hat kein Mensch gekämpft – dafür lohnt es nicht.
Kein Mensch kämpfte für das Zerhacken in LGBTIQRLMABC_*, keine Sau starb für die nackten Ärsche des Berliner CSD-Karnevals, der sich nicht entblödet, immer noch von sich als „politischer Demonstration“ zu fabulieren, und erst recht hat sich niemand für die minutiös faschistisch durchgeführte Sprachverstümmelung ins Zeug gelegt, deren dilettantische Abartigkeit jedem halbwegs denkenden Menschen den Herpes ins Großhirn pflanzt.
Wir sind nicht dafür gerade gestanden, dass aus unseren Reihen Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden, einfach weil man es kann. Wir wollten nie toleriert werden, sondern akzeptiert. Nicht mehr, nicht weniger.
Und hier trennt sich mein Weg von der SPD unter Nahles, denn sie will nicht nur toleriert, akzeptiert, sondern auch gewählt werden. Alles drei fällt mir schwer, es ist geradezu unmöglich. Und in mir gärt dieser zutiefst ärgerliche Gedanke, dass es um die heutige Community (weltweit) ähnlich steht wie um die SPD – zerfranst, zerlebt, ohne Fokus, um das Über-Ich einer diffusen Korrektheit bemüht, ohne zu wissen, aus welchem Kern sie denn eigentlich besteht. Vielleicht, möchte man meinen, hat sie ihren Kern einmal zu oft gespalten?