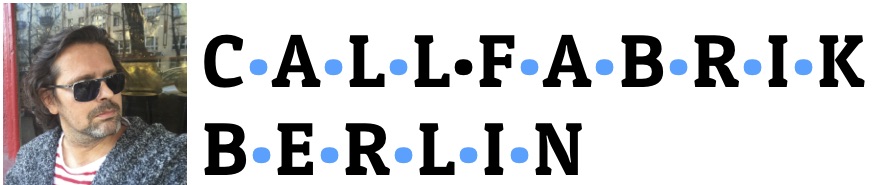Ein Thema in diesen Tagen ist die vorgeblich gender-gerechte Sprache. Was im Ansatz schon nachdenklich stimmt, denn eine Sprache an sich ist keine Persönlichkeit und kann deswegen von sich aus Recht und Unrecht voneinander nicht unterscheiden. Das Ziel der Gender-Studies, die sich ja zuvörderst dem Sprachgebrauch widmen, ist die alle Geschlechter einbindende Bezeichnungspolitik, die sowohl integrativ als auch individualistisch umgestaltet werden soll – in der Grundthese eine Quadratur des Kreises.
Schon seit Jahren werden hier _ und * bedient, aus den vom Sinn her geschlechtsneutralen Lesern werden so Leser*Innen, bzw. Leser_innen, in der letzten Konsequenz Lesende.
Einmal abgesehen von der Unmöglichkeit, sich durch solcherart gegenderte Textmonstren zu arbeiten, werden hier schlicht und ergreifend Fehlinformationen zum Besten gegeben.
So ist der Radfahrende nur solange Rad-fahrend, wie er auf dem Fahrrad sitzt und dieser Tätigkeit nachgeht. Der Überbegriff des (überzeugten) Radfahrers wird dabei im Ruhezustand ausgeblendet. Der Dialog: „Fährst Du Auto?“ „Nein, ich bin Radfahrer“ ist in diesen gar nicht so neuartigen Konstrukten nicht möglich. Die itzund korrekte Antwort müsste lauten: „Nein, ich bin Radfahrender“, was den Auskunftsgebenden zur Lüge zwingt, es sei denn, er ist in dem Moment in den Sattel gepresst und quält die Pedale.
Etymologisch und literaturhistorisch sind derlei Quälgeist-Formulierungen unhaltbar. Jeder Daumen ist ein Finger, aber nicht jeder Finger ein Daumen. Aber es geht hier nicht um Wissenschaft, schon gar nicht um Wissen, sondern um eine hoch ideologisierte Debatte, die, lautstark angeheizt von einer verschwindend kleinen Elite, zur Unzeit kommt.
Wieso dieses?
Die angestrebten Veränderungen sind nicht aus Notwendigkeit gewachsen. So wie die Anglizismen wuchsen, die sich durch die amerikanischen und britischen Besatzungsmächte bereits seit den 1950’ern in die deutsche Sprache mischten. Oder, um eine noch wesentlich längere Historie zu bemühen, den französischen Wortschatz, der sich bereits im Mittealter fröhlich in den Grenzgebieten in die Mundart mengte. „Trottoir“, „Plumeau“, „mais“ – all das sind handelsübliche Begriffe, die sich wie selbstverständlich ins Rhein- oder auch Saarland gewanzt haben. Sie sind Bestandteile geworden – sie sind hineingewachsen.
Dazu gehören natürlich auch historische Fehlleistungen. Eines der berühmtesten Stücke Molières beispielsweise heißt „Le Malade imaginaire“ und wird auf deutschen Spielplänen als „Der eingebildete Kranke“ präsentiert. Das schießt haarscharf am Inhalt des Dramas vorbei, denn es handelt es sich nicht etwa um einen Kranken, der sich zu Unrecht übermäßig hoch bewertet, sondern um einen „eingebildet Kranken“, einen Hypochonder also. Da ist jedes Aufbegehren zwecklos, niemand möchte sich einem kurzen und logischen Gedankengang unterziehen.
Dasselbe geschieht nun auf nerv-tötende Weise bei den Kriegern, bzw. Kriegenden, im Schattenboxen um Gendergerechtigkeit. Von „Studierenden“ wird da gesprochen, von „antragstellenden Personen“, von „Mietenden“, und völlig unbeeindruckt von sachlichem Widerspruch der Wissenschaftler wird die Sprache kastriert.
Das Erschreckende dabei ist, wie viele junge Menschen sich mit Verve in die sackgassige Diskussion werfen und dabei so tun, als ginge es hier um nichts Geringeres als die überfällige Durchsetzung der Menschenrechte. Gerne wird dabei die Rassismus-Karte gezückt – dass es schließlich auch geradezu autoritärer Maßnahmen bedurfte, Unwörter wie „Nigger“, „Neger“ oder „Bimbo“ aus dem gängigen Wortschatz zu eliminieren (ich nehme hier die Satire aus, die solche Termini nutzt, um sie ad absurdum zu führen). Ungeachtet der Tatsache, dass man diesen objektiven Erfolg vor allem den Anti-Rassismus-Bewegungen der in den USA lebenden Afroamerikaner verdankt, die seit hundert Jahren gegen die offene Diskriminierung in einer Gesellschaft kämpfen, die sie als Sklaven importierte und ihnen bis heute profundes Unrecht antut. Auch dies also ist „gewachsen“.
Der Gender-Irrsinn hat seine traurigen Wurzeln nicht nur im Feminismus, sondern in der Homosexuellenszene, die sich seit drei Jahrzehnten lustvoll zerlegt und indes jede, teils schlichtweg erfundene, Neigung mit einem eigenen Buchstaben belegt: LGBTIQR* oder wie auch immer. Diese Aufreihung führt, es ist schon bei einigen klugen Köpfen angekommen, nicht etwa zur Gleichberechtigung, sondern zur Spaltung, Zerfaserung, Zergliederung, bei der wirklich kein Schwein mehr mitkommt. Ein geschätzter Kollege führte das zuletzt in seiner Online-Kolumne aus, in der er seinen Entschluss bekanntgab, fürderhin nur noch über „queere Menschen“ zu schreiben. Willkommen im Club! Und, ganz nebenbei, handelt es sich ebenso bei „queer“ um einen gewachsenen Anglizismus, der seit Stonewall, spätestens aber seit dem Act-up!-Movement eine international feste Größe bedeutet.
Im Theater oder Showbiz galt immer die Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum“. Man darf gespannt sein, wann dort die Abrissbirne eingesetzt wird.
Wann behauptet wird, die Erstnennung der Damen sei eine archaische Floskel, die in gekünstelter Höflichkeit die Frau diskriminiert, und man möge sich auf „liebes Publikum“ beschränken, wobei man dies durch das Adjektiv auf eine Gesinnungshaltung festlegt, also einfach nur noch „Publikum“ sagen. Der Tag dürfte nicht fern sein.
Oberbegriffe wie „Kollegen“, „Zuhörer“, „Schüler“ haben rein gar nichts mit Sexismus zu tun und dienten auch zu keiner Zeit der Diskriminierung. Dafür wurden ganz andere Wörter politisch konnotiert – Führer, Volk und Vaterland. Eine übergestülpte Sprachverwendung hat immer den fauligen Ruch der Demagogisierung. Um nichts anderes handelt es sich bei der seit Jahren betriebenen Genderesierung – aus was für hehren, vielleicht gar edlen Motiven sie auch betrieben wird.
Ich als Literat und Journalist verweigere mich freilich diesem grassierenden Unsinn. Die Schönheit des lebenden und wachsenden Körpers Sprache konnte selbst die NDR nicht ausrotten – und ja, ich schreibe immer noch Portemonnaie im Gegensatz zu Portmonee. Denn ich weiß, woher das Wort stammt, aus dem Französischen nämlich, und ich finde es nicht verachtenswert, das zu lernen. Ein sensibler Umgang mit dem Sprachschatz impliziert, sich seiner Historie und Wirkung bewusst zu sein – ganz gewiss nicht, sie bis zur Verkrüppelung zu beschneiden.
An einer früheren Stelle dieses Textes schrieb ich, die Diskussion (deren Entwicklung ich bereits seit drei Jahrzehnten verfolge) komme zur Unzeit. Denn sie spielt den Populisten in die Hände; denen, die jene bedienen, die vorgeblich nicht abgeholt wurden. Sie ist schlicht und ergreifend nicht zweckdienlich, trägt kein bisschen zur Gleichberechtigung bei und entsteht in einer Blase, die spätestens beim Verlassen urbaner Zusammenhänge zerplatzt.
Gerade in unserer Nation sollte deutlich davor gewarnt werden, das Wort politisierend zu instrumentalisieren. Unsere Erfahrungen diesbezüglich waren nicht die ruhmreichsten.